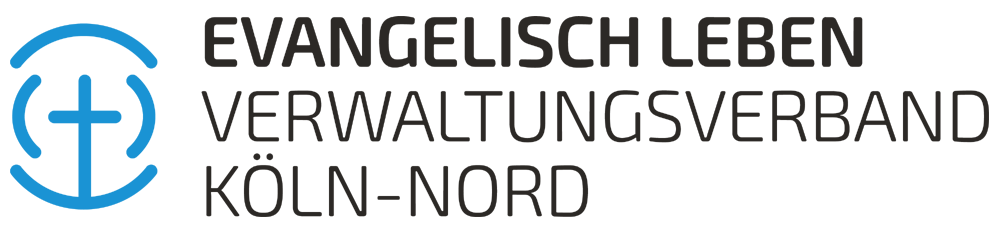Christian Lehnert ist ein Solitär in der deutschen Lyrik-Landschaft. Seine Texte sind formal nicht experimentell, sondern bedienen sich ganz bewusst eher aus dem traditionellen Formenschatz. Seine Themen findet der 1969 in Leipzig geborene studierte Theologe, ehemalige Pfarrer und Studienleiter sowohl in der Natur als auch an den Grenzbereichen des Lebens. Wo drängende Fragen unbeantwortet bleiben, wo die naturwissenschaftliche Evidenz endet, da übernimmt bei ihm die Poesie, das „dichtende Herz“ (Luther).
Auch in Köln hat Christian Lehnert, der sich seit Oktober aus dem universitären Leben zurückgezogen hat und sich ganz dem Schreiben widmet, offensichtlich eine beachtliche Fangemeinde. Bereits im November 2018 war er für eine Lesung zu Gast im Baptisterium. Im Haus der Evangelischen Kirche las Christian Lehnert nun unter dem Motto „Offen für das Unverfügbare“ aus „Op. 8. Im Flechtwerk“, „Ins Innere hinaus“ und „Das Haus und das Lamm“.
Während es sich bei den anderen beiden Bänden um „suchende, erkundende Prosa“ handele, sei der Gedichtband „Im Flechtwerk“ ein „natürliches Buch“ mit „kurzen Naturbeschreibungen, die sich zu einem Ganzen verweben“. An der Grenze zwischen Beobachtung und Wahrnehmung öffnet Lehnert behutsam das „Buch der Natur“, das für alle, die sehen wollen, so manche Offenbarung bereithält. Die musikalische Struktur der 7 x 7 Gedichtpaare ist dabei ebenso wenig Zufall wie der Titelbestandteil „op. 8“, hat Lehnert doch auch Libretti für den Komponisten Hans Werner Henze verfasst.
Auch Autobiografisches fügt sich nahtlos in dieses Kaleidoskop aus meditativen Naturbetrachtungen und tastend-assoziativen Prosa-Miniaturen ein. So berichtet Lehnert, wie er im Frühjahr 1989 mit anderen wehrdienstverweigernden Bausoldaten in den Chemiewerken Leuna nach einer Havarie eine zähflüssige Substanz zu entfernen hatte und Lehnerts Erinnerungen aus dem „Freigehege“ DDR bieten durchaus Anknüpfungspunkte an aktuelle Freiheitsdiskurse.
Nach dem ersten Lesungsblock kam Christian Lehnert mit Norbert Bauer (Leiter der Karl Rahner Akademie) und Martin Bock (Leiter der Melanchthon Akademie) ins Gespräch. Norbert Bauer berichtete zunächst von einem Aha-Effekt, den eine von Lehnert erzählte Anekdote bei ihm ausgelöst habe. Lehnert berichtete damals von einem Gottesdienstbesuch mit Hans Werner Henze, der bei diesem Anlass gesagt habe: „Ihr Christen macht einen Fehler. Ihr tut so, als hättet ihr Gott verstanden.“ Christian Lehnert entgegnete, dass Gott verstehen „eine paradoxe Formulierung“ sei. Die Kirche sei, so Lehnert, bisweilen „eine Institution zur Transzendenzverhütung“. Martin Bock beschrieb seine Erfahrung mit biblischen Texten „als Räume der Fremdheit und des Nicht-Verstehens“ und stellte dann die angesichts des Mitgliederschwunds scheinbar unvermeidliche Frage: „Was machen unsere Kirchen falsch?“ Christian Lehnert betonte daraufhin, dass er „kein geborener Kirchenkritiker“ sei. Religion bestehe für ihn in „Brucherfahrungen“ und er sei beeindruckt gewesen von der Ernsthaftigkeit von Religion in der ehemaligen DDR.
„Wo beginnt der Gottesdienst?“
Norbert Bauer stellte das binäre Konzept von religiös und säkular infrage und wollte wissen: „Wo beginnt der Gottesdienst?“ Die Antwort ließ einmal mehr Lehnerts Doppelkompetenz als Theologe (ehemaliger Leiter des Liturgiewissenschaftlichen Instituts) und Schriftsteller erkennen: Wie ein Gedicht brauche der Gottesdienst eine innere Form, eine innere Struktur. Martin Bock äußerte die Vermutung, es handele sich bei der zunehmenden Abwendung von den beiden „großen“ Kirchen nicht um eine Abneigung, sondern um „Entwöhnung“. Christian Lehnert entgegnete im Rückgriff auf seine eigene biografische Erfahrung, Kirchenferne gehöre zum „traditionellen Selbstverständnis“ in der ehemaligen DDR und wandte sich gleichzeitig gegen etwaige (Re)Missionierungsversuche: „Menschen sind sehr empfindlich, wenn eine Überzeugungsabsicht erkennbar ist“, erklärte er. Die Aufgabe sei vielmehr, Neugier zu erzeugen.
Im zweiten Lesungsblock stellte Lehnert zunächst zwei längere Texte vor. In „Der Wächter“ beschreibt er einen Sonderling (Lehnert bezeichnete ihn als eine Art „religiösen Zeugen“), der, auf den ersten Blick in verwahrlostem Zustand, lange Spaziergänge um das Dorf macht und von seinen Wanderungen allerlei Fundstücke mitbringt, die er manchmal herumzeigt. „Dass niemand ihre geheime Botschaft, ihre Signatur verstand, störte ihn nicht.“ Wird der Kauz gefragt, was er denn da tue, lautet die Antwort: „Ich bewache das Dorf.“ Auf die Nachfrage „Wovor?“ kann er nur erwidern: „Wenn ich das wüsste …“
„Der Tanz“ schildert den Auftritt eines gealterten Ausdruckstänzers in einer Kirche, eine Choreografie zu Bachs „Wohltemperierten Klavier“. In diesem Text wird der Tanz zu „Gebetsversuchen vertieft“ und Aufgang und Abgang von der Bühne werden zu existenziellen Lebensmetaphern. Den Abschluss bildeten drei Gedichte aus „Op. 8. Im Flechtwerk“
Wie sehr Christian Lehnerts Texte auch die Seelen der Zuhörer*innen erreichten, machte eine berührende Wortmeldung aus dem Publikum deutlich. Ein Mann erzählte, dass er vor zwei Wochen seinen Vater verloren habe und er zum ersten Mal wieder ausgegangen sei, weil er sich so sehr auf diese Veranstaltung gefreut habe. Nun fühle er einen unglaublichen Schmerz, aber gleichzeitig sei er auf wunderbare Weise versöhnt. Dann bat er den Dichter, doch etwas zum Tod zu sagen. Dieses Ansinnen hätte allerdings den Rahmen des Abends gesprengt und war wohl auch eher an den Theologen als an den Poeten gerichtet, und so blieb Lehnerts Antwort ziemlich knapp. Der Tod sei die „absolute Grenze“ und „Es gibt über ihn nichts zu wissen!“ Er ist das Unverfügbare schlechthin.
Text: Priska Mielke
Foto(s): Priska Mielke
Der Beitrag Auf dem Weg des Suchens und des Lauschens: Theologe und Lyriker Christian Lehnert im Haus der Evangelischen Kirche erschien zuerst auf Evangelischer Kirchenverband Köln und Region.