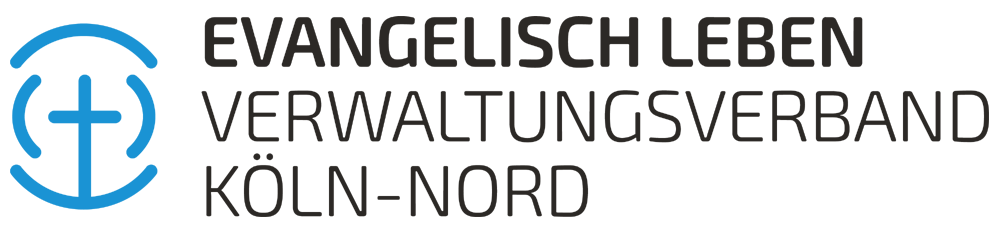Traditionell vor dem Geburtsfest der Kirche hat die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Bayenthal und die katholische Pfarreiengemeinschaft „Köln – Am Südkreuz“ einen ökumenischen Gottesdienst mit Pfingstfeuer gefeiert. Nach dem zentralen Teil in der Reformationskirche in Köln-Marienburg versammelten sich die Teilnehmenden auf dem Kirchplatz um eine Schale mit brennendem Scheitholz. Bei fortschreitender Dämmerung wurde auch dort gesungen und gebetet. Mitglieder des ökumenischen Arbeitskreises der beiden Gemeinden sprachen Fürbitten, und Pfarrer Seiger erteilte den Segen. Anschließend folgten viele der Einladung zur Begegnung bei Grillgut und Getränken.
„Vier Dinge“ wurden gefeiert
„Wir feiern heute Abend vier Dinge“, sagte der evangelische Pfarrer Bernhard Seiger in seiner Begrüßung. „Erstens: 1700 Jahre nicänisches Glaubensbekenntnis.“ Das im Jahr 325 im kleinasiatischen Nicäa – dem heutigen Anatolien – von Kaiser Konstantin einberufene Konzil sei das erste der gesamten Christenheit gewesen. „Die Bischofsversammlung formulierte Bekenntnisworte, die noch im 21. Jahrhundert von Bedeutung sind. Wenn man so will, ist dieses Konzil der Grundstein der Ökumene gewesen“, erläuterte Seiger. Menschen aus allen damals beteiligten Kirchen und Ländern seien zusammengekommen.
Über dieses Konzil könne man ganze Forschungsseminare veranstalten. Heute gehe es vor allem um die Frage: „Wie finden wir gegenwärtig die richtigen Worte von Gott und unserem Glauben?“ Dabei half Pfarrer Dr. Martin Bock, Leiter der Melanchthon-Akademie im Evangelischen Kirchenverband Köln und Region, mit seiner Predigt ins Thema einzuführen.
Neue Komposition des Glaubensbekenntnisses vorgestellt
„Zweitens feiern wir die Aufführung einer Neukomposition“, kündigte Seiger an. Das nicänische Glaubensbekenntnis wurde neu vertont – durch insgesamt sechs Komponistinnen und Komponisten weltweit. „Unser Glaube ist weltumspannend, und das soll diese internationale Komposition zum Ausdruck bringen“, erklärte er. Das vom Carus-Verlag initiierte und umgesetzte Projekt besteht aus sechs Teilen der Vertonung des lateinischen Textes.
Zur Aufführung kamen die beiden Stücke „Crucifixus“ (Kreuzigung) und „Et resurrexit“ (Auferstehung) aus dem Mittelteil des Credo. „Unser Kantor Samuel Dobernecker ist wohl der erste Kantor, der einen Teil dieser Gesamtkomposition zur Aufführung bringt – und unser Vokalensemble die erste Gruppe, die sich daran versucht hat, mit nur drei Wochen Probezeit“, sagte Seiger anerkennend. Ein sehr gelungenes Experiment, wie die Zuhörenden feststellen durften.
Lokale Ökumene als lebendige Gemeinschaft
„Drittens feiern wir unsere lokale Ökumene“, wandte sich Seiger an evangelische und katholische Christinnen und Christen aus Zollstock, Bayenthal, Raderthal und Marienburg. Er hieß namentlich seinen katholischen Kollegen Wolfgang Zierke willkommen, „mit dem wir seit vielen Jahren diese ökumenischen Gottesdienste feiern“. Besonders freute sich Seiger darüber, dass erneut der ökumenische Arbeitskreis den Gottesdienst vorbereitet und liturgisch mitgestaltet hatte.
Pfingsten: Gottes Geist belebt
„Und viertens: Wir feiern Pfingsten. Dass Gottes Geist uns belebt, dass Gott da ist, wir den offenen Himmel erleben und etwas von seiner Kraft in uns aufnehmen können“, betonte Pfarrer Seiger.
Dichte und musikalische Predigt über das nicänische Bekenntnis
In seiner spannenden Predigt ging Martin Bock auf das 1700 Jahre alte Glaubensbekenntnis von Nicäa ein. Der Leiter der Melanchthon-Akademie und Vorstandsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Köln sprach über die geistliche Musik und darüber, wie das Verkleiden der Worte des Glaubensbekenntnisses in Töne und Klänge helfen kann, Gottes Gegenwart zu erfahren.
Bock erinnerte an eine ökumenische Tagung von MAK und Karl Rahner Akademie, bei der 150 Menschen über die Frage diskutierten, wie man der theologischen Sprachlosigkeit in der Mitte der Gemeinden begegnen könne. Das Fazit: „So uninteressant ist es wohl doch nicht, was der biblische Gott mit unserer indifferenten Welt zu tun hat.“
Die Kraft des Glaubens in polarisierten Zeiten
Schon vor 1700 Jahren hätten sich Christen gefragt, ob ihr Glaube genügend Kraft habe, sich gegen andere Weltanschauungen durchzusetzen. „Es ging darum, ob der biblische Glaube etwas mit dieser Welt zu tun hat“, sagte Bock. Er sprach von einem „grenzgängerischen Ringen“ auf jüdischer wie christlicher Seite – darum, das Bekenntnis zum einen Gott nicht im Pluralismus aufzugeben.
Besonders bewegend findet Bock, dass sich in dieser Situation vermeintlich geschlossene Grenzen wieder öffnen konnten – zwischen Judentum und Christentum. Das wiederkehrende Bekenntnis zum einen Gott sei zentral gewesen – eine gemeinsame Suche nach einem verbindenden Kern.
Ein Glaubensbekenntnis als Taufbekenntnis
Bock verwies darauf, dass sich wenige Jahre vor 325 Kaiser Konstantin für das Christentum entschieden habe – politisch, aber auch persönlich. Das Glaubensbekenntnis von Nicäa sei deshalb mehr als eine theologische Formulierung: „Es ist ein Taufbekenntnis. Es hält fest, worauf ich mich einlasse, wenn ich Christ werde.“
Gott zu bekennen, sei etwas Ganzheitliches, nicht nur eine Sache des Kopfes. „Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft“ – so verstehe es schon das Erste Testament. Auch die Musik und der Bibeltext aus dem Philipperbrief entstünden in diesem Resonanzraum.
Musik als Resonanzraum des Glaubens
„Der Philipper-Hymnus ist ein Lied. Wir wissen nicht, wie er geklungen hat, aber klar ist: Für dieses unglaubliche Geschehen zwischen Himmel und Erde gibt es nicht nur Worte, sondern Worte, die in Töne und Klänge gekleidet sind“, sagte Bock. In orthodoxer Liturgie etwa wird der Glaube gesungen, nicht gesprochen. „Der Glaube, der mich mit anderen und mit Gott verbindet, wird gesungen.“
Hoffnung und Widerstand aus Kiew
Besonders eindrücklich war die Komposition „Et resurrexit“ der ukrainischen Komponistin Victoria Vita Poleva, entstanden mitten im Krieg in Kiew. „Immer wieder haben Bomben den Kontakt unterbrochen“, berichtete Bock. Entsprechend klang ihre Musik: „ein stilles, trotziges, innerliches Lob der Auferstehung – eine flehentliche Friedensbitte.“ Ein Kontrapunkt zu den Taten der Mächtigen.
Zweifel als existenzielle Töne
Auch Zweifel seien Bestandteil des Glaubens. Bock erinnerte an die Frauen am leeren Grab, an die Worte aus dem Philipperbrief: „Er wurde wie ein Sklave … bis zum Tod.“ Das Glaubensbekenntnis vertone diese Menschwerdung Gottes.
Bock erzählte von einer orthodoxen Theologin, die sagte: „Mein persönlicher Glaube ist viel zu schwach. Ich brauche diesen uralten Text, der mich trägt. Ich brauche den geselligen Gott.“
Der gesellige Gott und unsere Gegenwart
Kann das Bild vom geselligen Gott etwas mit der Einsamkeit vieler Menschen heute tun? Bock glaubt: ja. Das Konzil von Nicäa habe damit begonnen, was wir heute weiterspinnen sollten: „Es ist doch nicht irgendetwas, wenn Gott nichts anderes tut, als den Menschen zu suchen und ihn in sein Leben zurückzuholen.“
Und so zitierte Bock zum Schluss einen Menschen, der nach einem Leben voller Theologie sagte: „Ich glaube nicht nur an die gesellige Gottheit – ich lebe in ihr.“
Uraufführung des vollständigen Werkes im Kölner Dom
Die Uraufführung der kompletten Neukomposition des Glaubensbekenntnisses von Nicäa findet am Freitag, 26. September, um 16:30 Uhr im Kölner Dom statt – im Rahmen der Dreikönigswallfahrt und eines Gottesdienstes der ACK.
Text: Engelbert Broich
Foto(s): Engelbert Broich
Der Beitrag Reformationskirche in Köln-Marienburg: Ökumenischer Gottesdienst mit Pfingstfeuer erschien zuerst auf Evangelischer Kirchenverband Köln und Region.